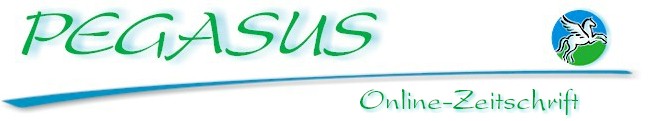|
|
Pegasus 1/ 2000, 1
Roland Frölich
Fächer verbindender
Projektunterricht und seine Reduktionsformen im Fach Latein
1. Definitionen
2. Merkmale
des Projektunterrichts
3. Reduktionsformen
des Projektunterrichts
4. Literaturhinweise
4.1. Projektunterricht
(allgemein)
4.2. Projektunterricht
im Fach Latein
4.3. Methodenkompetenz
4.4. Internetadressen
5. Beispiele
5.1. Arbeitspläne
5.1.1. Organisation
eines Gesamtprojektes/ der
Arbeit in Kleingruppen
5.1.2. Organisation
einer externen Präsentation
5.2. Fächer
verbindendes Projekt: "Die Welt der
Atome"
5.2.1. Bemerkungen
zur Organisation, Durchführung, Evaluation
5.2.2. Arbeitsplan
zur Organisation des Gesamtprojektes
5.2.3. Arbeitsplan
einer Kleingruppe
5.2.4. Arbeitsplan
zur externen Präsentation
5.2.5. Fragebogen
5.2.6. Kursarbeit
Pegasus 2/ 2001, 15
1. Definitionen1
Fächer verbindend: Verschiedene Fächer einigen
sich auf ein gemeinsames Rahmenthema (meist in Form eines Projektes).
fachübergreifend: Das Fach Latein gibt als
Pilotfach ein Thema vor. Ein anderes Fach ergänzt dies durch Beiträge.
facherweiternd: Die Fachlehrer/-innen erweitern
im Rahmen ihres Unterrichts das Thema durch Aspekte anderer Fächer.
Projektunterricht ist eine (besondere) Unterrichtsform, in der
Lehrer/-innen und Schüler/-innen
- an einem gemeinsam formulierten Thema/Problem arbeiten,
- zu dessen Bearbeitung einen Arbeitsplan entwickeln,
- sich arbeitsteilig mit der Lösung beschäftigen,
- die Lösung(sversuche) anderen vermitteln
- und/oder in einem gemeinsamen Produkt präsentieren
2. Merkmale des
Projektunterrichts
Aus den genannten Definitionen ergeben sich unmittelbar nachstehende konstitutive
Elemente des (Fächer verbindenden) Projektunterrichts:
Interdisziplinarität: Verschiedene Fächer verschmelzen für
die Dauer des durchzuführenden Projektes. Ein loses Nebeneinander der Fächer
unter einem Leitthema (z.B. "Französische Revolution") ohne
gemeinsame, fächerübergreifende Leitfrage(n) genügt in der Regel nicht.
Vielmehr ist das Formulieren einer oder auch mehrerer Leitfragen,
die im Verlaufe des Projektes beantwortet werden sollen, für den Erfolg
des Projektes wichtig. Zur Bearbeitung dieser Leitfragen, die gleichsam
als "Roter Faden" durch das Projekt führen, trägt dann jedes
Fach seinen Teil bei.
Hierbei sollte sich ein Projekt stets an
- Lehrplan,
- Fragen und Interessen
der Beteiligten (!!!) und
unter Umständen an
- gesellschaftlichen Problemen orientieren.
- Eine (größtmögliche) Selbstständigkeit und Selbstorganisation
der Schüler/-innen ist anzustreben bei der
- Formulierung
des zu bearbeitenden Problems und der Ziele
- Beschaffung der notwendigen Arbeitsmittel und Informationen
zur Lösung
des Problems
- Planung des Arbeitsprozesses
:
- Erstellen eines Arbeitsplanes
- Aufteilung der Großgruppe in Kleingruppen
- Verteilung der Arbeitsaufträge in den Groß- und Kleingruppen
- Präsentation der Arbeitsergebnisse sowohl innerhalb der
Kleingruppen als auch der Großgruppe
- Produkt
Pegasus 2/ 2001, 16
- Durchführung, Einhaltung, Überprüfung
(und Abänderung) des Arbeitsplanes.
Hierzu kann immer wieder die eigentliche Arbeit in den Kleingruppen oder
auch in der Großgruppe unterbrochen werden. Auch können in einem
Klassengespräch Informationsphasen über den Stand der Arbeit (z.B. in
den einzelnen Kleingruppen) eingeschaltet werden. Ein Arbeitsprotokoll
kann hier unterstützend wirken;
- unter Umständen können die Arbeitsergebnisse einer größeren Öffentlichkeit
präsentiert werden. Hierzu ist eine erneute Planungsphase einschließlich
des Erstellens eines zweiten Arbeitsplanes
für die Präsentation notwendig.
- Beurteilung der Arbeitsergebnisse
(hinsichtlich der
Arbeitsergebnisse, Produkte, Präsentationen, aber auch der Kooperation
der Lerngruppe untereinander und des Arbeitsklimas ...)
Aus den bisherigen Ausführungen ergeben sich nun unmittelbar weitere
Charakteristika des Projektunterrichts:
Die Lehrperson zieht sich weitestgehend zurück, da nur so
ein selbstständiges Arbeiten der Schüler/-innen gewährleistet ist.
Das Problem bzw. die Ziele des Projektes werden arbeitsteilig
bearbeitet.
Eine konsequente Produktorientierung trägt hierbei wesentlich
zum Erfolg des Projektes bei. Insbesondere werden die Schüler/-innen
angehalten, ergebnisorientiert zu arbeiten. Ein Ergebnis wird von
allen angestrebt.
Die Schüler/-innen bearbeiten also im wahrsten Sinne des Wortes ihre
Projektfrage(n)/ -problem handlungsorientiert. Das Einbeziehen
vieler Sinne (z.B. indem Schüler/-innen etwas sehen, hören, (er)fühlen)
ergibt sich hieraus zwangsläufig.
Soziales Lernen erfolgt während des gesamten Projektes, da durch
die arbeitsteilige Bearbeitung und die Konzeption der Arbeitspläne
- das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen für die Klein- und Großgruppe,
aber auch für das Gelingen des gesamten Projektes,
- gegenseitige Rücksichtsnahme (z.B. in Diskussionen) sowie
- die Kritik- und Kommunikationsfähigkeit gestärkt werden.
Die Förderung der "Teamfähigkeit" ist somit ein wichtiges
Lernziel dieser methodischen Großform.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Jedes Projekt durchläuft 4
Phasen:
1. Vorlauf: Themenwahl/-findung, Projektfragen
Die Identifikation der Schüler/-innen mit dem Projekt ist hierbei
von entscheidender Bedeutung
==> Schüler/-innen sollten unbedingt selbst das
Projektthema wählen und eigene Projektfragen
aufwerfen/formulieren, die der Lehrperson als Orientierung dienen können.
2. Planung: Planung der Großschritte, Einteilung der
Kleingruppen, Formulierung der Arbeitsaufträge für die Kleingruppen
(schriftliche Fixierung der Planungsergebnisse z.B. in einem Arbeitsplan
!!)
3. Durchführung: Wechsel zwischen Arbeiten im Plenum und
in Kleingruppen mit Erarbeitungs-, Präsentations- und evtl. weiteren
Planungsphasen (z.B. falls das Projekt aus mehreren Teilen besteht, eine
externe Präsentation zu planen ist, usw.). Die Anfertigung eines
Arbeitsprotokolls kann in dieser Durchführungsphase insbesondere bei
umfangreichen Projekten sinnvoll sein. So entsteht eine Dokumentation der
Arbeit, die in der anschließenden Auswertung/ Reflexionsphase sehr gut
herangezogen werden kann.
Pegasus 2/ 2001, 17
4. Auswertung/Reflexion:
- Gedankenaustausch über Projektplan, Projektverlauf,
Gesamtergebnis durch die bzw. mit den Schüler/-innen (unter Umständen
auch schriftlich in Form eines Statements)
- Fragebogen (anonym !) zu
methodisch-strategischen, sozial-kommunikativen und affektiven
Aspekten des Projektes, aber auch zur Überprüfung der diesbezüglichen
Lernziele
- Unter Umständen Klassen-/Kursarbeit/Test
zur Überprüfung der inhaltlich-fachlichen Lernziele
3.
Reduktionsformen im Unterricht
- Zu geringe Methodenkompetenz der Schüler/-innen, (u.U. aber auch
der Lehrperson),
- Stundenplan (v.a. bei fächerverbindenden Projekten mit mehreren
Lehrpersonen),
- 45 Minuten-Rhythmus
- Alter der Schüler/-innen
lassen den "reinen" Projektunterricht im Schulalltag häufig
nur selten zu. Daher ist es oft nötig, das Ideal des Projektunterrichts
(in einem oder auch mehreren Aspekten) einer Reduktion zu unterziehen.
Folgende Reduktionsschritte scheinen sinnvoll:2
| Projektunterricht |
Projektorientierter
Unterricht
|
Kein
Projektunterricht
|
| Elemente |
|
1. Abstufung |
2. Abstufung |
|
| Thema/Inhalt |
Schüler bestimmen
das Thema und die Inhalte |
Schüler u. Lehrer
legen gem. nach LP Thema fest |
Schüler wählen aus
vom Lehrer vorgegebenen Themen |
Lehrer legt das Thema
alleine fest |
| Materialien |
Schüler beschaffen
sich die Materialien |
Schüler und Lehrer beschaffen zusammen Material |
Schüler wählen aus
vorgegebenen Materialien |
Material liegt
aufbereitet vollständig vor |
| Arbeitsziele |
Schüler formulieren
Problem(e) und Ziele selbstständig |
Schüler und Lehrer
legen gemeinsam Ziele fest |
Schüler wählen aus
vorgegebenen Zielen einen Lernzielkatalog aus |
Ziele werden vom
Lehrer festgesetzt |
| Methoden |
Freie Lernwegwahl
durch Schüler. Arbeit auch außerhalb der Schule |
Auswahl aus
angebotenen Lernwegen |
Lernwegempfehlung |
Lehrer schreibt
Lernweg vor |
| Lerngruppe |
Freie Gruppenwahl
nach Interesse und Neigung/heterogen |
Gruppen homogen
gebildet |
Lehrer nimmt Einfluss
auf Gruppenbildung |
Keine Gruppenarbeit |
| Fächer3 |
Mehrere Fächer
verbindend; mehrere Lehrer |
Ein Fach ist
Pilotfach, ein oder zwei Fächer treten hinzu (fachübergreifend) |
Ein Fach und Ausblicke (fächererweiternd)
|
Eng fachspezifisch;
nur ein Lehrer |
| Beurteilung der
Arbeit |
Kritik am
Projektverlauf durch die Schüler selbst |
Schüler u. Lehrer
kritisieren gemeinsam |
Bewertung durch den
Lehrer wird diskutiert |
Benotung durch den
Lehrer |
| "Produkt" |
Im Voraus geplante
Lernaktivitäten realisieren sich in einem "Produkt" |
Planung erst während
der Arbeit/teilweise realisieren sich Lernaktivitäten |
Produkt
scheitert/wird reflektiert |
Keine Produktplanung
und -durchführung |
| Schülerrolle |
Selbst- (und mit-)
bestimmend/selbst-ständig/aktiv planend und durchführend |
Mitbestimmend/
teilweise selbst-ständig/aktiv |
Mitbestimmend/auswählend/aktive
und passive Arbeitsphasen |
Passiver Rezipient |
| Lehrerrolle |
Integrativ; fast ganz zurücktretend/beratend auf Wunsch;
jedoch Aufsicht
|
Zurückhaltend/koordinierend/ Vorschläge
und Hinweise
|
Stark strukturierend/
verbindliche Empfehlungen |
Dominant steuernd in
allen Bereichen |
Pegasus 2/ 2001, 18
4. Literaturhinweise
4.1. Projektunterricht
(allgemein)
Bastian, J.: Freie Arbeit und Projektunterricht, in: Pädagogik
10/1993, 6ff
Bastian, J./Gudjons, H. (Hrsg.): Das Projektbuch I. Theorie,
Praxisbeispiele, Erfahrungen. Hamburg 1986
Bastian, J./Gudjons, H. (Hrsg.): Das Projektbuch II. Über die
Projektwoche hinaus. Projektlernen im Fachunterricht. Hamburg 19932
Bastian, J./Gudjons, H.: Das Projekt: Projektunterricht, in: Pädagogik
7-8/ 1993, 73 ff.
Gudjons, H.: Projektunterricht begründen. Sozialisationstheoretische
und lernpsychologische Argumente. Spaß in der Schule: Gut, aber nicht
ausreichend. In: Bastian, J., Gudjons, H. (Hrsg.): Das Projektbuch II. Über
die Projektwoche hinaus. Projektlernen im Fachunterricht. Hamburg 19932
Flitzner, A.: Serie "praktisches Lernen". In: Pädagogik
49/1988, Hefte 9 - 12
Frey, K.: Die Projektmethode. Weinheim/Basel 1983
Klipatrick, W.H.: Der Projektplan. Grundlegung und Praxis.
Herausgegeben von Peter Petersen, Weimar 1935, 85 - 101
Münzinger, W. (Hrsg.): Chemie in Projekten. Frankfurt/Main 1984
Pädagogisches Zentrum des Landes Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Mit Freuden
lernen (Bd. 2: Projektorientiertes Lernen). Bad Kreuznach 1992
Rüttgers, J./ Hentig, H. von: Lernen in einer Medienwelt. In: Die
Zeit, Nr. 39 v. 29.9.97, 50
Scheller, I.: Erfahrungsbezogener Unterricht. Praxis, Planung, Theorie.
Frankfurt/Main 19872
Wolters, A.: Projekt- und fachübergreifender Unterricht. In: Bovet/
Huwendiek (Hrsg.): Leitfaden Schulpraxis. Pädagogik und Psychologie für
den Lehrberuf. Berlin 1994, 157 – 196, 20003 , 92-121
4.2. (Fächer verbindender)
Projektunterricht im Fach Latein
Freitag, Chr.: Altsprachlicher Unterricht und Moderne Kunst. Lektüreprojekte.
Bamberg, 1994 (Auxilia-Band 35)
Hellmuth, D.: Lateinunterricht am Computer und einige praktische
Anregungen. Forum Classicum
1/99, 16 – 19 (mit Hinweisen/Tipps zum Erstellen eines eigenen
Buches)
Lohe, P./ Maier, F. (Hrsg.): Latein 2000. Existenzprobleme und Schlüsselqualifikationen.
Analysen, Konzepte und Projekte des Deutschen Altphilologenverbandes.
Bamberg 1996, 17 – 96 (mit Anregungen
zu verschiedenen umfassenden Unterrichtsprojekten)
Maier, Fr.: Europa – Ikarus – Orpheus. Abendländische
Symbolfiguren in Ovids Metamorphosen. Fächerverbindende Projekte.
Erschienen in der Buchner-Reihe "Antike und Gegenwart" Bamberg
1998
Maier, Fr.: Grundtexte Europas. Epochale Ereignisse und
Existenzprobleme der Menschheit. Projekte zum fächerübergreifenden
Unterricht. Erschienen zusammen mit einem Lehrerkommentar in der
Buchner-Reihe "Antike und Gegenwart" Bamberg 1995
Maier, Fr. u.a.: Latein auf neuen Wegen. Alternative Formen des
Unterrichts. Impulse aus den Arbeitskreisen des Bundeskongresses des
Deutschen Altphilologenverbandes 1998 in Heidelberg. (Auxilia- Band 44).
Bamberg 1999
Schäfer, R.: Kinder entdecken römische Spiele und ein Stück
Vergangenheit. Grundschulzeitschrift (ersch. im Friedrich-Verlag) 1998, 42
– 46; 82 – 89 (mit Kopiervorlagen)
AU 3+4/94: "Handlungsorientierter Unterricht" mit möglichen
Produkten im (Projektunterricht)
AU 2/97, S. 3f.: Hinweis auf das Projekt "Dido und Aeneas –
Erzählung, Szenen, Bilder, Räume".
AU 1/98: Projektunterricht mit Beispielen (Luxus, Aeneis IV,
Zeitung), theoretische Abhandlungen und ausführlicher
Literaturliste
AU 6/1999: Produktionsorientierte Unterrichtsphasen mit vielen
Anregungen und Unterrichtsbeispielen für Projekt-/projektorientierten
Unterricht
Pegasus 2/ 2001, 19
4.3. Methodenkompetenz
Bundesarbeitsgemeinschaft der jungen Philologen im Deutschen
Philologenverband: Methodentraining für die Schule von morgen. Kreativität
und Wissen. Mainz 1999
Klippert, H.: Methodentraining. Übungsbausteine für den Unterricht.
Weinheim/Basel 1995³
Meyer, M.A./Rampillon, U./Otto, G./ Terhart, E. (Hrsg.): Lernmethoden
– Lehrmethoden. Wehe zur Selbstständigkeit. (Friedrich Jahresheft XV).
Seelze 1997
Pädagogisches Zentrum des Landes Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Immer mehr
Medien ... . Ein Gewinn für die Schule? Pädagogische Nachrichten 1/99.
Bad Kreuznach 1999
Pädagogisches Zentrum des Landes Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Offene
Lernsituationen und selbstständiges Lernen. Pädagogische Nachrichten
2/99. Bad Kreuznach 1999
Verband der Schulbuchverlage e.V. (Hrsg.): Werkstatt Multimedia.
Chancen von Multimedia und Internet im Unterricht. Frankfurt 1999
4.4. Internetadressen4
Allgemeine Übersichtsseiten für Altertumswissenschaften/Suchmaschinen
http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2latein/home.html
(Top-Übersichtsseite)
http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2latein/ressourc/ressourc.html
(Top-Übersichtseite)
http://www.latine.de/LLL01.htm
("Gottweins" Link-Liste)
http://home.t-online.de/home/dr.fechner/links.htm
("Fechners" Link-Liste)
http://educeth.ethz.ch/altphilo
(Links auch zu Unterrichtsmaterialien)
http://www.bildung-rp.de/LMZ/latein.pht
(Lateinseite auf dem rheinland-pfälzischen Bildungsserver)
Lateinische Texte im Internet
http://patriot.net/~lillard/cp/latlib
(The Latin Library)
http://www.geocities.com/Athens/Forum/6946/literature.html
(Römische Literatur)
http://etext.lib.virginia.edu/latin.html
(Electronic Text Center der Universität von Virginia)
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/a_index.html
(Lateinische Texte)
Griechische Texte im Internet
http://www.perseus.tufts.edu/Texts/chunk_TOC.grk.html
(Griechische Texte bei Perseus)
http://www.arts.cornell.edu/classics/Faculty/Rusten/greekkeys/FAQ.htm
(FAQ zur Darstellung griechischer Schrift)
http://classics.mit.edu/
(The Internet Classics Archiv)
Pegasus 2/ 2001, 20
Unterrichtsmaterialien
http://www.zum.de./schule/schule.html
(Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V. (ZUM) - Das Internet
als Lern und Lehrhilfe)
http://dbs.schule.de/lehrer.html
(Deutscher Bildungsserver DBS)
http://www.uni-karlsruhe.de/~za192/latein/indexla.htm
(Virtuelle Schule im Netz: Latein und Griechisch)
http://www.geocities.com/CollegePark/Gym/3410/latein.htm
(Lateinseiten der Homepage von Dieter Kaufmann)
http://educeth.ethz.ch/altphilo/#latein
(Alte Sprachen)
http://www.fu-berlin.de/klassphi/didaktik/Medien.htm
(Mediensammlung zum altsprachlichen Unterricht)
http://www.w-4.de/~tbhahfn/comla.html
(Computer im Lateinunterricht)
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/tchmat.html
(Latin Teaching Materials)
5. Beispiele
5.1. Arbeitspläne
1. Beispiel zur Organisation des Gesamtprojekts oder
2. auch nur der Arbeit in Teilgruppen
|
Wann?
|
Was?
|
Wer?
|
Wo?
|
Kontrolle?
|
|
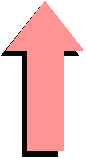
|
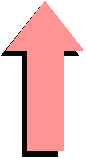
|
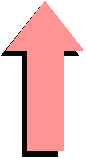
|
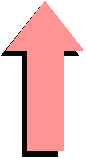
|
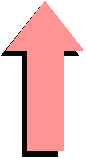
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeiträume
|
Gegenstand/Themen, die zu
bearbeiten sind
|
Namen der Schüler/-innen, die
jeweils ein Teilthema zu bearbeiten haben; unter Umständen sind
auch Lehrpersonen hier zu nennen
|
Ort(e), an denen die Themen/Probleme
zu bearbeiten sind
|
Überprüfung der Arbeit durch
Produkte/Präsentation der Ergebnisse/...
|
Pegasus 2/ 2001, 21
Anmerkungen:
-
Selten ist zusätzlich als weitere Rubrik
"benötigte Hilfe?" einzufügen! Diese Funktion kann meist
auch die "Wer?-Rubrik" übernehmen, indem die helfende Person
in dieser Rubrik eingetragen wird.
-
Solche Arbeitspläne
-
- vermeiden das "Abseilen" einzelner
Schüler/-innen bzw. einzelner Teilgruppen
-
-geben den Schüler/-innen und Lehrpersonen einen
(zeitlichen, personellen und inhaltlichen) Rahmen
-
-halten die Schüler/-innen an,
produktbezogen/ergebnisorientiert zu arbeiten
-
Arbeitspläne / Übersichten über den geplanten
Projektverlauf sollten die Schüler/-innen möglichst selbstständig
(z.B. in einem Rundgespräch) erstellen!
-
Arbeitspläne, v.a. Übersichten über den geplanten
Projektverlauf können und müssen im Verlauf des Projektes immer wieder
überprüft und gegebenenfalls auch korrigiert/ergänzt/geändert
werden.
5.1.2.
Beispiel zur Organisation einer externen Präsentation:
|
(Teil-)Themen
|
Aspekte (der (Teil-)Themen)
|
Produkte
|
Ort
|
Ausführende
|
benötigte Materialien
|
|
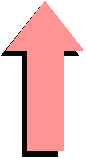
|
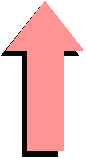
|
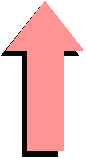
|
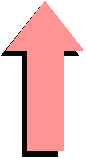
|
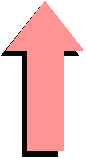
|
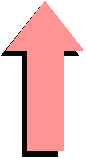
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art des Produktes (z.B.
Modell/ Plakat/ Hörspiel/Zeitung/...)
|
z.B. Stellen im Schulhaus
|
|
z.B. Tische/Stellwände/
Klebeband/Stifte/usw.
|
Anmerkungen:
Selten ist zusätzlich als weitere Rubrik
"benötigte Hilfe?" einzufügen! Diese Funktion kann meist
auch die Rubrik "Ausführende" übernehmen, indem die
helfende(n) Person(en) (z.B. Hausmeister, Lehrpersonen, Eltern, ...) in
dieser Rubrik eingetragen werden.
Solche Pläne
-vermeiden das
"Abseilen" einzelner Schüler/-innen bzw. einzelner Teilgruppen
-geben den
Schüler/-innen und Lehrpersonen einen (personellen und inhaltlichen)
Rahmen
- halten die
Schüler/-innen an, Produkte/Arbeitsergebnisse für eine größere
Öffentlichkeit zu überarbeiten
- schützen
(ein wenig) vor Überraschungen/ungelösten Problemen/Lücken/....
Solche Pläne können oft erst gegen Ende eines
Projektes erstellt werden.
Jedenfalls sollten auch diese Planungsübersichten die
Schüler/-innen möglichst selbstständig (z.B. in einem Rundgespräch)
erarbeiten!
Pegasus 2/ 2001, 22
5.2. Fächer
verbindendes Projekt "Die Welt der Atome"5
5.2.1.
Bemerkungen zur Organisation, Durchführung und Evaluation
beteiligte Fächer: Latein, Physik, Griechisch, (Kunst)
beteiligter Kurs: Leistungskurs Latein MSS 12 des St.
Franziskus-Gymnasiums in Kaiserslautern
beteiligte Lehrpersonen:
R. Frölich (Gesamtleitung des Projektes; Schwerpunkte
Latein/Griechisch)
P. Hüther (Schwerpunkt Physik)
G. Künzel (Bereitstellung griechischer Texte und
Beratung)
Organisation: - Zeitraum: 14.12.1999 (1
Unterrichtsstunde):
Themenfindung und Projektfragen
04.01.1999 – 23.02.1999 (30 U-stunden):
a): Annäherung an das Thema;
b): Lukrez, De rerum natura;
c): - Moderne Atomphysik,
- Die griech. Atomisten;
d): Evaluation (Fragebogen
+ Kursarbeit)
13.04.1999 (4 Unterrichtsstunden ): Vorbereitung der
externen Präsentation
- Phasen a), b) und d) fanden in den regulär im
Stundenplan ausgewiesenen Lateinstunden, Phase c) sowie die
Vorbereitung der externen Präsentation in Blockunterricht zu je 4
U-Stunden statt;
- Physik- und Lateinlehrkraft gestalteten gemeinsam
den Unterricht in der Annäherungsphase sowie bei den
Präsentationen der einzelnen Gruppenarbeitsergebnisse innerhalb des
Kurses; die Kursarbeit wurde ebenfalls gemeinsam konzipiert und je
nach Schwerpunkt korrigiert
- in den restlichen Phasen unterrichteten Physik-
und Lateinlehrkraft je nach Schwerpunkt der Projektphase getrennt;
- sämtliche Planungsschritte (Setzung der
inhaltlichen Schwerpunkte, Ausstellung ja/nein, ...) und weitere
organisatorische Entscheidungen (Gruppeneinteilung, Verteilung der
Gruppenarbeitsaufträge, ...) führten die Schülerinnen
selbstständig durch.
Pegasus 2/
2001, 23
Rückblick/Evaluation: Grundlagen der nachstehenden
Bemerkungen zum Verlauf und Erfolg des Projektes sind:
-
Beobachtungen der beteiligten Lehrpersonen
-
Persönliche Gespräche mit den
Schülerinnen
-
Klassengespräch
-
Hand-Outs
-
Auswertung des anonym ausgefüllten Fragebogens
-
Auswertung der Kursarbeit
-
Fachliche Aspekte: Aufgrund der zweisprachigen
Bearbeitung der lateinischen wie griechischen Texte konnten sich alle
Schülerinnen die Inhalte trotz der nicht immer leicht zu verstehenden
deutschen Übersetzungen selbstständig erarbeiten und die
Kernaussagen mit entsprechenden Zitaten belegen. Daneben wurden in der
Lukrez-Phase von den Schülerinnen ausgewählte Textpassagen
weitgehend richtig übersetzt. Die überarbeiteten Übersetzungen
waren neben den selbst angefertigten Atommodellen und durchgeführten
Versuchen jeweils Schwerpunkt der internen und externen
Präsentationen. Zwei Schülerinnen äußerten nach Ende des Projektes
sogar den Wunsch, weitere Lukrez-Texte im Rahmen des ´normalen´
Unterrichts zu übersetzen. Die physikalischen Probleme konnten ebenso
weitgehend selbstständig bewältigt werden.
Die Kursarbeit fiel in allen
Teilen im Vergleich zu den konventionellen Kursarbeiten
überdurchschnittlich gut (10,2 Punkte) aus. Insbesondere konnten auch die
Schülerinnen, die in der Oberstufe das Fach Physik nicht belegt haben, im
Physik-Teil die Aufgaben zufriedenstellend bis gut bewältigen. Die
arbeitsteiligen Gruppenarbeitsphasen wirkten sich hierbei wohl aufgrund
der durchweg gelungenen internen Präsentationen und der dazu gehörigen
Hand-Outs nicht negativ auf die Leistungen aus. Zwei Schülerinnen
und die zahlreichen, immer wieder überarbeiteten Arbeitspläne
(für
zur Bewältigung der außerordentlich großen
methodischen Anforderungen und damit zum Erfolg des Projektes wesentlich
bei.
Pegasus 2/ 2001, 24
Die Schüler/-innen selbst äußerten sich durchweg
positiv und fühlten sich zu keiner Zeit mit der selbstständigen
Planung und Durchführung des Projektes überfordert. Lediglich die
Tatsache, dass zu Beginn der ersten arbeitsteiligen Gruppenarbeitsphase
die Arbeit zwischen den einzelnen Gruppen zu wenig abgesprochen war und
sich daher zum Teil eine Überschneidung der Arbeitsergebnisse ergab,
wurde kritisiert. Diese Erkenntnis wurde bei den nachfolgenden
arbeitsteiligen Gruppenarbeitsphasen Gewinn bringend umgesetzt.
-
Organisatorische Aspekte: Der in unmittelbarem
Zusammenhang mit den genannten methodischen Aspekten stehende
organisatorische Aufwand (zwei Lehrer, mehrere Fächer,
Projektnachmittage, zahlreiche Präsentationsfolien, sehr
ausführliche Hand-Outs, externe Ausstellung über zwei Stockwerke
hinweg, ...) hat sich sicherlich gelohnt. Insbesondere die intensiven
Arbeitsphasen über den 45 Minuten-Rhythmus hinaus wurden von den
Schülerinnen als wohltuend empfunden und trugen wesentlich zum Erfolg
des Projektes bei.
-
Sozial-kommunikative Aspekte: Die Unterrichts- bzw.
Arbeitsatmosphäre war in allen Phasen des Projektes durchweg gut, in
vielen Stunden sogar sehr gut. Insbesondere äußerten sich die
Schülerinnen neben der bereits erwähnten zu geringen Absprache
zwischen den einzelnen Gruppen zu Beginn der Lukrez-Phase durchweg
positiv zu ihrer Arbeit in den Kleingruppen. Selbst eine zum Teil
etwas unzuverlässige Schülerin konnte weitgehend zu einer
kooperativen, verlässlichen Mitarbeit motiviert werden. Insgesamt
wurden durch die zahlreichen Gruppenarbeitsphasen und die vielen
internen Präsentationen die schon vor dem Projekt gute, z.T. sogar
sehr gute Sozial- und Kommunikationskompetenz der Schülerinnen noch
einmal verbessert.
-
Affektive Aspekte: Die Schülerinnen waren sichtlich
zufrieden, die Ziele und Fragen, die sie zu Beginn des Projektes
selbst formuliert hatten, erreicht zu haben, aber auch sowohl ihren
eigenen (hohen) Ansprüchen wie auch denen der Lehrpersonen gerecht
geworden zu sein. Der Erfolg der externen Ausstellung, insbesondere
die positive Resonanz aus allen Teilen der Schulgemeinschaft
(Schülerschaft, Lehrerkollegium, Schulleitung, Konvent) und das
große Interesse an der Projektmappe, die sich aus den Handouts der
internen Präsentationen zusammensetzte und über 100 mal verkauft
wurde, erfüllten die Schülerinnen - auch noch im zeitlichen Abstand
- mit großem Stolz. Alle Schülerinnen hatten das Gefühl, etwas
Besonderes geleistet zu haben.
Während der Arbeit fühlten sich die Schülerinnen sehr
wohl, selbst die zum Teil heftigen und sehr engagierten Diskussionen
während der Arbeit wurden im Nachhinein als notwendig gewertet und als
wertvolle Erfahrung empfunden. Auch erspürt zu haben, dass jede
Schülerin unmittelbar selbst durch ihr verantwortungsvolles,
zielgerichtetes Tun zum Erfolg einer Unternehmung wesentlich beiträgt,
beeindruckte die Schülerinnen nach eigenen Aussagen ungemein.
Pegasus 2/ 2001, 25
5.2.2. Arbeitsplan zur
Organisation des Gesamtprojektes:
(Vorläufige) Planung des Projektverlaufes
|
Wann? |
Was? |
Wer? |
Wo? |
Kontrolle? |
|
04.01. - 05.01.1999
|
Annäherung an das Thema |
Alle Schülerinnen (Plenum-Einzelarbeit) |
Kursraum |
Planungsübersicht für das Projekt |
|
06.01. – 21.01.1999
.
.
.
.
22.1.1999
|
Lukrez:
- Definition, Namen,
Aussehen, Arten
- Fundamentalsätze
- Atomeigenschaften
Präsentationen |
Gruppen
|
Kursraum
zu Hause
|
Präsentation
für jeweils andere Gruppen
|
|
26.01.1999
nachmittags
.
.
02.02.1999
.
nachmittags
.
.
.
.
.
05.02.1999 5.
Stunde
|
Moderne Atomphysik:
1. Phase:
- Aussehen
- Eigenschaften
Präsentation der
Phase 1
2. Phase:
- Anwendungen
- Grenze des Atoms
- Zusammensetzung
- Existenz
- Ursprung
Präsentation der Phase 2 |
alle Schülerinnen,
ohne "Griechen"
.
.
alle Schülerinnen
Gruppen
.
.
.
.
.
alle Schülerinnen
|
Physik
.
.
.
.
.
Physik
.
.
.
.
.
Kursraum
|
Präsentation
mit Hand-Outs
für jeweils andere
Gruppen
.
.
Präsentation mit
Hand-Outs für
jeweils
andere Gruppen
|
|
26.01.1999 und
02.02.1999
nachmittags
08.02.1999
|
Griechen
.
.
Präsentation der Griechen |
eine Schülerin
.
.
alle Schülerinnen
|
Bibliothek
.
.
Kursraum
|
Präsentation mit
Hand-Outs für
Physik-Gruppen |
|
02.02.1999
(1. und 2. Stunde)
|
Ethik
Vorbereitung der öffentlichen Präsentation
|
alle Schülerinnen
|
Kursraum
|
Ausstellung
|
|
Hinweise auf
Ausstellung
|
- "Fragen", die auf die
Thematik neugierig
machen
- Durchsage
|
- Kopien mit entsprechenden Fragen
|
- ganzes Schulhaus
|
Gruppen |
Anmerkung: Dieser Projektplan wurde mehrmals
überarbeitet, v.a. den äußeren Rahmenbedingungen immer wieder
angepasst!!
Pegasus 2/ 2001, 26
5.2.3.
Arbeitsplan einer Kleingruppe:
Gruppe "Definition/Namen/Art/Aussehen der
Atome"
|
Wann? |
Was? |
Wer? |
Wo? |
Kontrolle? |
|
06.01.1999
- 13.01.1999
|
Teambesprechung
Arbeitsaufteilung:
- Gestalt Vielfalt, Aussehen der Atome
- Definition, Name, Ursprung der Atome
|
5 Schülerinnen
Gruppen |
Kursraum
Klasse u. zu Hause
Klasse u. zu Hause
|
Arbeitsplan für Gruppe
Unterlagen in jeweiligen Stunden mitbringen
|
|
13.01.1999 |
Vergleich und gegenseitige Präsentation
Präsentationen |
Gesamte Kleingruppe |
Kursraum |
Vergleich und Zusammentragen des Erarbeiteten
|
|
15.01.1999
und
19.01.1999
|
Vorbereitung für die gesamte Präsentation
|
Gesamte Kleingruppe
|
Klasse und zu Hause |
Modelle und Plakat |
5.2.4.
Arbeitsplan zur externen Präsentation:
Externe Präsentation
|
|
Aspekte |
Produkte |
Ort |
Ausführende |
Materialien |
|
Hand-Outs für die Besucher |
alle |
Blättermappe |
Erdgeschoss;
2. Stock |
Lehrer |
- Diskette
- alte, überarb. Hand-Outs
- Kopien
|
|
Griechische Atomisten |
Überblick über die einzelnen Lehren
|
"Säulenhalle"
Versuche
Plakate
Bilder
|
Erdgeschoss |
Schülerin |
- Säulen aus
Theater-Fundus
- 2 Tische
- Bettlaken
|
|
Lukrez, De rerum natura |
Fundamentalsätze
.
Eigenschaften
.
.
Aussehen
|
- Banner (mit lat.
Zitaten)
- Plakate (mit lat.
Zitaten)
- Versuche
- Modelle
- Plakate (mit lat.
Zitaten)
|
Erdgeschoss
.
Erdgeschoss
.
.
Erdgeschoss
|
Schülerinnen
Schülerinnen
.
.
Schülerinnen
|
-Befestigungsmaterialien
- 2 Stellwände
- 2 Tische
.
.
- 2 Stellwände
|
Pegasus 2/ 2001, 27
|
|
Moderne Atomphysik
|
Atommodelle
.
.
.
.
Urknall
.Nutzen
und
Gefahren/ Vor-
und Nachteile |
Modell (zur
Quantenphysik)
Modelle (aus der
Chemie)
Plakate
Bilder
Interkommunikatives
Plakat
Bilder
|
2. Stock |
Schülerinnen |
- 1 Tisch
.
- 2 Tische
.
- 2 Stellwände
- 1 Stellwand
- 1 Stellwand
.
- 1 Stellwand
|
|
Verbindung der Ausstellungsbereiche |
"Rotes Band"
mit einer
Zeitleiste
.
"Füße"
|
Rotes Band
|
Treppenhaus
vom
Erdgesch.
zum 2. Stock
Treppenhaus vom Erdgesch. zum 2. Stock; Erdgesch.,
2. St. |
.
.
.
.
Schülerinnen |
- Rotes Band
-Bettlaken
-Befestigungsmaterialien
.
- Folien,
- Tesa-Film
- "Füße" aus Papier |
|
Hinweise auf
Ausstellung
|
"Fragen", die auf
die Thematik
neugierig machen
Durchsage |
Kopien mit
entsprechenden
Fragen
|
ganzes Schulhaus
|
Schülerinnen |
- Kopien
- Tesa-Film
.
- Text
|
Pegasus 2/ 2001, 28
5.2.5. Fragebogen
zum Projekt "Welt der Atome"
|
Meine Meinung zum Projekt "Die Welt der Atome":
1. Wurden deine Erwartungen an das Projekt erfüllt?
.
2. Scheint dir der Versuch, mehrere Fächer (Latein, Griechisch
bzw. Philosophie, Physik) im Rahmen eines solchen Projektes
miteinander zu verbinden, sinnvoll?
3. Lohnt sich deiner Meinung nach der Aufwand (2 Lehrer,
Projektnachmittage, Präsentationsfolien, ... ?
 ja
ja
 nein
nein
Warum ?
.
4. 5 Wochen an diesem Projekt zu arbeiten waren
 okay
okay
 zu
viel
zu
viel
 eher zu wenig.
eher zu wenig.
Warum?
.
5. Wie empfandest du die Unterrichtsatmosphäre während der
Arbeit am Projekt?
.
6. Die Arbeit in der Gruppe hat
 sehr gut
sehr gut  gut
gut  mittelmäßig
mittelmäßig  eher nicht
eher nicht  überhaupt nicht
überhaupt nicht
geklappt. Warum ?
.
Pegasus 2/
2001, 29
.
7. Die Präsentationen waren
 verständlich
verständlich
 unverständlich
unverständlich
 informativ informativ
 langweilig. langweilig.
Die Anzahl der Präsentationen waren
.
 zu
zahlreich
zu
zahlreich
 zu
wenig
zu
wenig
 in Ordnung.
in Ordnung.
.
8. Hast du das Gefühl,
.
 mehr
mehr
 weniger
weniger
 genauso viel
genauso viel
zu lernen als/wie im "normalen" Unterricht? Warum?
.
9. Hast du das Gefühl,
 mehr
mehr
 weniger
weniger
 genauso viel
genauso viel
gefordert zu sein als/wie im "normalen" Unterricht?
Warum?
.
10. Warst du mit der eigenverantwortlichen Planung der gesamten
Unterrichtsreihe überfordert?
.
 ja
ja
 zum
Teil
zum
Teil
 nein
nein
Warum?
.
11. Würdest du gerne zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an
einem solchen Projekt mitarbeiten? Warum (nicht)?
.
.
12. Weitere Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge:
.
.
.
Pegasus 2/
2001, 30
.
Frage 13 beschäftigt sich ausschließlich mit dem
"physikalischen Teil" des Projektes.
13) a) Ich habe Physik noch belegt !
 ja
ja
 nein
nein
b) War der "physikalische Teil" eine sinnvolle
Weiterführung des "lateinischen Teiles" ?
 ja
ja
 nein
nein
Warum ?
Warum ?
.
c) Wurden die dich interessierenden Fragen/Themen hinreichend
beantwortet/erläutert?
 ja
ja
 nein
nein
Wenn nein, welche Fragen/Themen blieben offen ?
.
d) Gib in kurzen Worten an, was du im "physikalischen
Teil" gelernt hast bzw. ob du (neue) Erkenntnisse gewonnen
hast!
...
e) Wie schwer fiel dir die Erarbeitung der physikalischen
Inhalte ?
 leicht
leicht
 mittel
mittel
 schwer
schwer
 zu schwer
zu schwer
Warum ?
.
f) Was hat dir besonders gefallen ?
.
g) Wo gab es Probleme ?
.
Vielen Dank für deine Mitarbeit !!! |
Pegasus 2/ 2001, 31
5.2.6.
Kursarbeit "Die Welt der Atome"
12 L 1
1. Kursarbeit in 12/2
23.02.1999
Name:
| Beachte
bitte:
1. Die lateinischen Texte sind nicht zu übersetzen,
sondern lediglich die Arbeitsaufträge/Fragen zu bearbeiten.
2. Verlangt sind jedoch stets
lateinische Zitate zur Unterstützung deiner
Aussagen, sofern diese sich auf die abgedruckten
lateinischen Texte beziehen |
Die
Welt der Atome
I. Lukrez und die Atomisten
1. a Lukrez nimmt mit seinem Werk `De rerum
natura´ in der römischen Literatur eine Sonderstellung
ein. Erläutere !
b Inwieweit greift Lukrez in seinem Werk
`De rerum natura´ Gedanken und Ideen auf, die bereits griechische
Philosophen vor ihm äußerten?
2. Lukrez formuliert
in den drei nachstehenden Textpassagen die sogenannten drei
Fundamentalsätze!
A: principium cuius hinc nobis
exordia sumet,
nullam rem e nihilo gigni
divinitus umquam.
B: huc accedit, uti quicque in sua corpora
rursum
dissolvat natura neque
ad nihilum interemat res.
C: nec tamen undique corporea stipata
tenentur
omnia natura; namque est
in rebus inane.
Formuliere für jede Textpassage eine
Überschrift und erläutere sie!
Pegasus 2/
2001, 32
3. An vielen Stellen äußert sich Lukrez zu Aussehen
und Eigenschaften der Atome. So
auch in den drei nachstehenden Textpassagen:
"Eigenschaften":
D: praeterea nisi materies aeterna fuisset,
antehac ad nihilum
penitus res quaeque redissent
de nihiloque renata
forent quaecumque videmus.
at quoniam supra docui
nil posse creari
5 de nihilo neque quod genitum est ad
nil revocari,
esse inmortali primordia
corpore debent,
dissolvi quo quaeque
supremo tempore possint,
materies ut suppeditet
rebus reparandis.
sunt igitur solida
primordia simplicitate
10 nec ratione queunt alia servata per aevum
ex infinito iam tempore
res reparare.
E: sed ne forte putes solo spoliata colore
corpora prima manere,
etiam secreta teporis
sunt ac frigoris omnino
calidique vaporis,
et sonitu sterila et
sucro ieiuna feruntur,
5 nec iaciunt ullum proprium de
corpore odorem.
Pegasus 2/
2001, 33
"Aussehen":
F: denique quae nobis durata ac spissa
videntur,
haec magis hamatis
inter sese esse necessest
et quasi ramosis alte
compacta teneri.
in quo iam genere in
primis adamantina saxa
(...)
5 illa quidem debent e levibus
atque rutundis
esse magis, fluvido
quae corpore liquida constant.
(...).
omnia postremo quae
puncto tempore cernis
diffugere, ut fumum,
nebulas flammasque, necessest,
si minus omnia sunt e
levibus atque rutundis,
10 at non esse tamen perplexis indupedita,
(...).
nec tamen haerere
inter se, quod cuique videmus
discidium esse datum
facile; ut cognoscere possis
non e perplexis, sed
acutis esse elementis.
a) Welche Informationen enthalten die
obenstehenden Textpassagen bzgl. Aussehen und Eigenschaften?
Erläutere!
b) Welche weiteren Aussagen bzgl. Eigenschaften und
Aussehen der Atome macht Lukrez an anderen Stellen? Erläutere
jeweils kurz die von dir angeführten Thesen!
Pegasus 2/
2001, 34
II. Lukrez und die moderne Physik
1) a) "Aufbau der Materie aus
Atomen"
G: nam tibi de summa caeli
ratione deumque
disserere incipiam et rerum primordia pandam,
unde omnis natura creet res, auctet alatque
quove eadem rursum natura perempta resolvat,
5 quae nos materiem
et genitalia corpora rebus
reddunda in ratione vocare et semina rerum
appellare suemus et haec eadem usurpare
corpora prima, quod ex illis sunt omnia primis.
1 Denn über letzten
Grund will ich dir von Himmel und Göttern
zu sprechen beginnen, will die der Dinge Atome zeigen,
aus denen alles die Natur erschafft, vermehrt und nährt,
in die sie zugleich die Natur dann wieder vernichtet und
auflöst;
5 wir sind gewohnt,
diese beim Beweis der Lehre
Stoff und Ursprungskörper der Dinge zu heißen und auch
Samen der Dinge zu nennen und eben diese zugleich zu
bezeichnen als die
ersten Körper, weil alles aus jenen zuerst ist.
Erläutere die heutige Vorstellung vom Aufbau
der Materie und setze sie in Bezug zu den von Lukrez in Text G
gemachten Aussagen.
Pegasus 2/
2001, 35
b) (Zusatzfrage)
"Jedes Ding besteht aus verschiedenen Atomen"
H: illud in his
obsignatum quoque rebus habere
convenit et memori mandatum mente tenere,
nil esse, in promptu quorum natura videtur,
quod genere ex uno consistat principiorum,
5 nec
quicquam quod non permixto semine constet;
et quodcumque magis vis multas possidet in se
atque potestates, ita plurima principiorum
in sese genera ac varias docet esse figuras.
.
1 Jenes
geziemt sich dabei besiegelt auch sicher zu haben
und fest im treuen Gedächtnis vertraut zu
halten,
dass nichts ist, von dem, dessen Wesen sich
offen zeigt,
was aus einem Geschlecht der Ursprungskörper
bestünde,
5 und
darum nichts, was nicht aus vermischtem Samen sich fände;
und was immer in höherem Grad viel Kräfte und
Mächte
in sich besitzt, hat auch um so mehr Arten von
Urkörpern
in sich und mannigfaltige Gestalten, wie damit
es lehret.
Beurteile diese Aussage (Text H) nach
heutigem Kenntnisstand!
Pegasus 2/
2001, 36
2a)
"Unzerstörbarkeit der Atome"
I: corpora sunt porro
partim primordia rerum,
partim concilio que constant principiorum.
sed quae sunt rerum primordia, nulla potest vis
stinguere; nam solido vincunt ea corpore demum.
.
Weiter sind Körper teils die Ursprungskörper der Dinge,
teils was aus dem Verein der Anfangskörper sich bildet.
Aber das, was die Ursprungskörper sind, kann keine Gewalt
auslöschen; denn sie siegen zuletzt durch ihren festen
Körper.
Beurteile diese Aussage (Text I) nach heutigem
Kenntnisstand!
b)
"Atome bewegen sich ständig"
J: at nunc nimirum requies
data principiorum
corporibus nullast, quia nil est funditus imum
quo quasi confluere et sedes ubi ponere possint.
semper in adsiduo motu res quaeque geruntur
5 partibus in cunctis
infernaque suppeditantur
ex infinito cita corpora materiai.
.
1 Jetzt aber ist
natürlich den Ursprungskörpern der Dinge
keine Ruhe geschenkt, weil nichts gänzlich das Tiefste ist,
wo sie hinfließen
und Wohnsitze begründen könnten.
Immer wird jegliches Ding in steter Bewegung getrieben
5 überall in
den Teilen, und dargereicht zur Ergänzung
werden die Körper des Stoffes, geschnellt aus unendlichem
Raum.
Auch der Aspekt der ständigen Bewegung findet
sich in der heutigen Atomvorstellung wieder. Erläutere diese
Vorstellung!
Pegasus 2/
2001, 37
c)
"Atome sind unsichtbar"
K: quod nequeunt oculis rerum
primordia cerni,
accipe praeterea quae corpora tute necessest
confiteare esse in rebus nec posse videri.
.
Weil mit den Augen Atome nicht erblickt werden können,
höre außerdem, was für Körperchen du selbst bekennen
musst,
dass sie in den Dingen sind und doch nicht gesehen werden
können.
Hat diese Aussage bis heute Gültigkeit?
Erläutere!
3. Während in der Antike der Begriff
"Atom" bei der Diskussion um den Aufbau der Materie die
wesentliche Rolle spielte, wurde er heute von dem Begriff
"Elementarteilchen" abgelöst.
Gib eine Definition für den Begriff
"Elementarteilchen" und nenne Beispiele!
4. Die bis heute gewonnenen Kenntnisse
über den Aufbau von Materie und Atome werden intensiv genutzt.
Nenne einige Anwendungen!
5. (Zusatzaufgabe)
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Atomen
und dem Periodensystem?
6. Nimm Stellung: Macht es Sinn, in heutiger
Zeit Lukrez zu lesen?
|
Pegasus 2/ 2001, 38
Anmerkungen:
1. vgl. Lehrplan Latein
Rheinland-Pfalz. Grund- und Leistungsfach. Jahrgangsstufen 11 bis 13 der
gymnasialen Oberstufe (Mainzer Studienstufe), 1998, 58
2. Münzinger, W. (Hrsg.):
Chemie in Projekten. Frankfurt/Main 1984, 5
3. vgl. Lehrplan Latein
Rheinland-Pfalz (1998), 58
4. Eine Einführung sowie
viele nützliche Internetadressen finden sich in:
Bechthold-Hengelhaupt, T.: Alte Sprachen
und neue Medien. Göttingen 2001
Kaufmann, D./Tiedemann, P.: Internet für
Althistoriker und Altphilologen. Eine praxisorientierte Einführung.
Darmstadt 1999
Schmitzer, U.: Antike und Internet – Eine
Einführung. In: Pegasus-onlinezeitschrift
1/2001. (http://www.pegasus-onlinezeitschrift.de/erga12001schmitzer.htm)
5. Das Projekt "Die
Welt der Atome" sowie die Beispiele des Fragebogens und der
Kursarbeit entstanden in Zusammenarbeit mit Frau StR i.P. Petra Hüther,
Kaiserslautern
Roland Frölich,
Wasserlochstücke 6,
67 661 Kaiserslautern
Email: RolandFroelich@aol.com
|